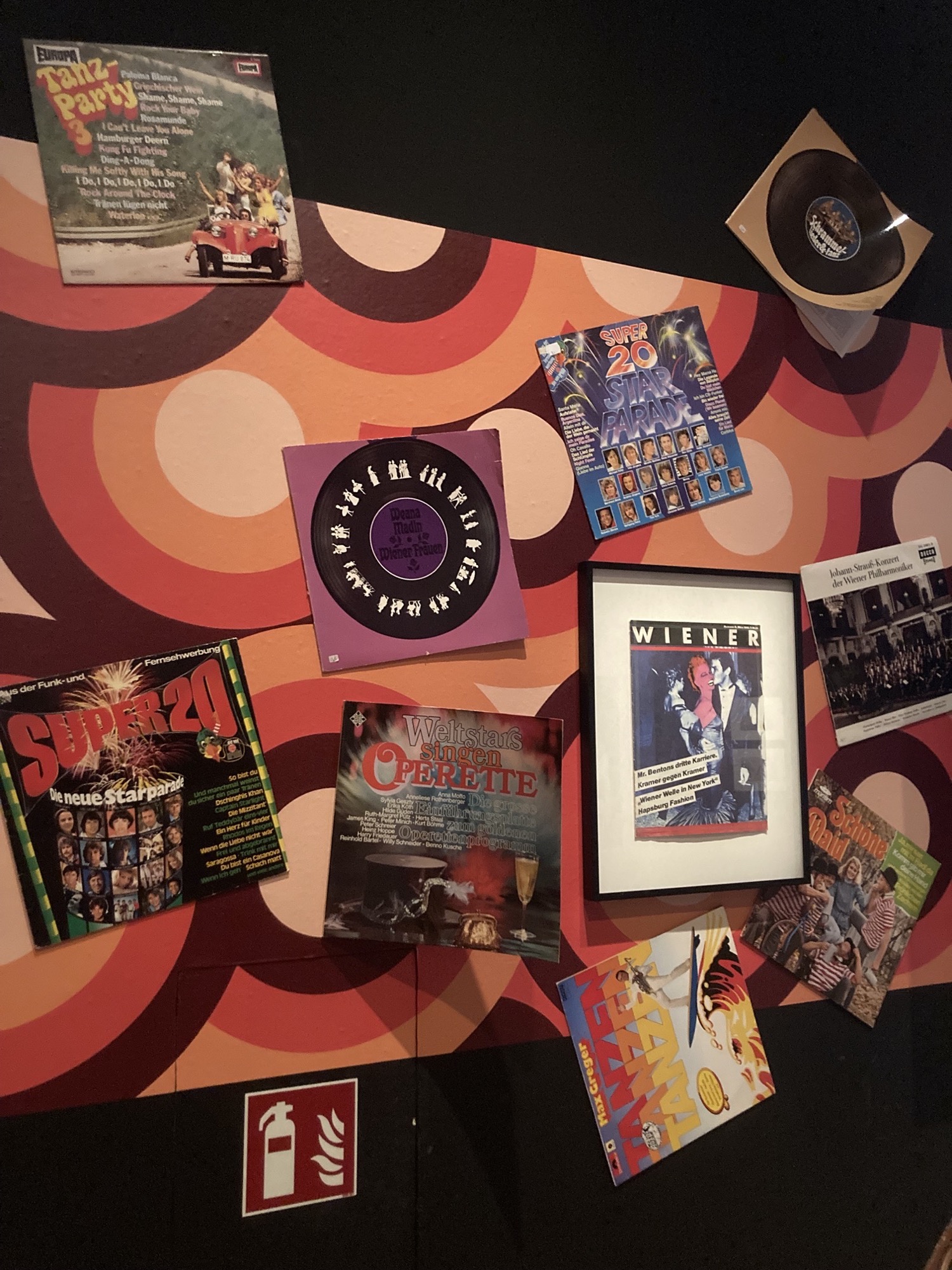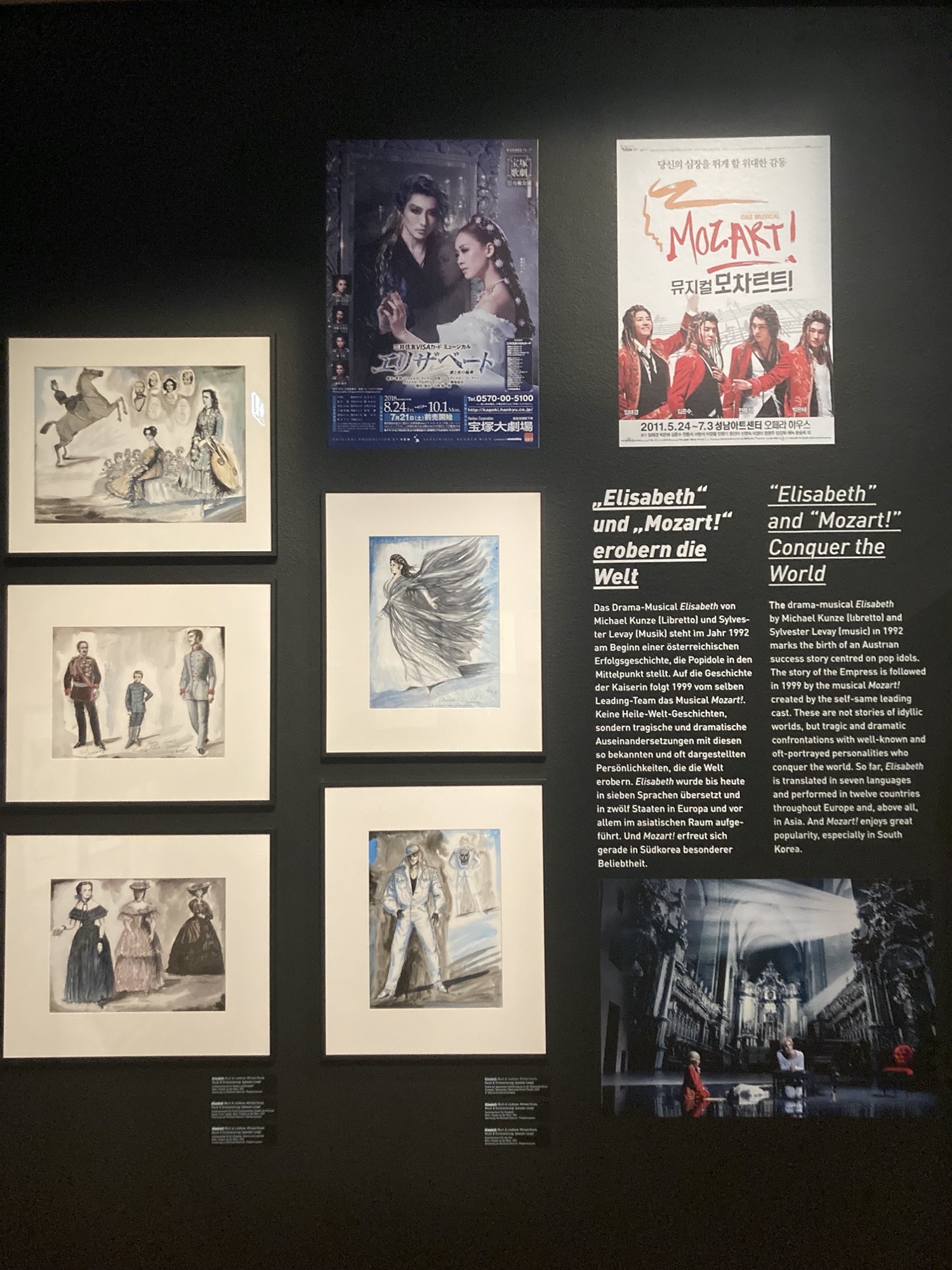CN: Die Autorin stellt jedem Kapitel eine Angabe der in diesem Kapitel thematisierten Krankheit(en) voran und ergänzt diese mit Triggerwarnungen. Diese Triggerwarnungen gebe ich hier gesammelt als Content Notice wieder:
Behindertenfeindlichkeit/Ableismus, Mobbing, Klaustrophobie, Verletzung, Blut, körperliche Gewalt, Alkoholmissbrauch, Depression, Stigmatisierung, Krankenhaus, Sexismus, Suizidgedanken
Kürzlich habe ich auf meinem Mastodon-Account nach Leseempfehlungen zu bestimmten Kriterien gefragt (die Sammlung der Empfehlungen ist in Arbeit, ich möchte mir alle Empfehlungen ansehen und etwas dazu schreiben) und dabei ist mir eingefallen, dass ich kürzlich einer Empfehlung von skalabyrinth folgend ein eBook heruntergeladen hatte, dass meinen Kriterien eigentlich vollumfänglich entspricht. Britta Redweik beschreibt in ihrem gratis auf BookRix erhältlichen Buch ihr Leben mit unterschiedlichen Behinderungen und Krankheiten und den gesellschaftlichen Konsequenzen mit denen sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation konfrontiert ist.
Bereits von Geburt an fehlt der Autorin ein Auge. Als Kind erlebt sie bereits den Aufwand, der damit verbunden ist, denn ein Glasauge muss (nicht nur bei Kindern) alle paar Monate erneuert werden und ist teuer. Sie beschreibt auch ausführlich, wie die Anpassung und Herstellung von Glasaugen funktioniert, ein Einblick, den vermutlich die wenigsten Menschen haben.
Aus ihrer Schulzeit berichtet sie von grausamen Mobbingerfahrungen, nicht nur durch Mitschüler:innen sondern auch durch Lehrkräfte. Wegen ihrer Skoliose kann sie nur eingeschränkt am Sportunterricht teilnehmen, wird jedoch trotzdem der Beurteilung unterworfen. (Noten für den Sportunterricht gehören meiner Meinung nach abgeschafft. Ja, ich war auch ein Kind, das immer zuletzt in die Mannschaft gewählt wurde.) Am Beispiel eines Korsetts, das sie wegen der Skoliose jahrelang tragen muss, erläutert sie auch ihre zunehmende Angst vor medizinischen Untersuchungen und Behandlungen. Viel zu oft unterwirft sie sich diesen nur, weil ihre Angst vor den drohenden Konsequenzen größer ist als ihre Angst vor den Behandlungen.
In ihren Exkursen über Behinderung in Deutschland sammelt Britta Redweik auch Fakten zum Beispiel über die Berechnung von Graden der Behinderung und dementsprechender Stufen finanzieller Unterstützung. Sie beschreibt ihre eigenen frustrierenden Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt, wo sie feststellen muss, dass selbst bei Stellenangeboten, die angeblich geeignet sein sollen für Menschen mit Einschränkungen, in der Praxis weder ausreichend Verständnis noch tatsächliche Flexibilität im Arbeitsalltag vorhanden ist. Sie erläutert ausführlich, warum es für behinderte Menschen so schwierig ist, einen Arbeitsplatz zu finden. Die Gesetze, die dabei helfen sollen, machen es leider oft erst recht schwer:
Man wird seltener eingestellt, weil man schwerer zu kündigen ist und mehr Anspruch auf Urlaub hat, aber auch wahrscheinlicher mal ausfällt.
Im Hinblick auf die mediale Repräsentation behinderter Menschen wünscht sich die Autorin, dass die Behinderungen auch in der Geschichte wichtig sein soll: „Entweder eine Botschaft über ,Schaut mal, ich schreib total inklusiv‘ hinaus haben, oder die Handlung oder Charakterentwicklung vorantreiben.“ Auf den nächsten Seiten beschreibt sie, dass ihr „echte Repräsentation“ wichtig ist, die „Einblick in das Leben des entsprechenden diversen Charakters“ gibt „und nicht nur zur Quotenerfüllung oder um sich tolerant zu fühlen“ dient.
Nur durch formal belegbare Qualifikationen kann ich beweisen, dass ich Leistung erbringen kann.
Aus der Sicht einer behinderten Person ist die Leistungsgesellschaft noch schlimmer zu ertragen. Aber auch die Erlangung der im obigen Zitat erwähnten Qualifikationen (wie zum Beispiel ein Universitätsabschluss) ist für behinderte Menschen mit massiven Hürden verbunden. Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten einiges in dieser Hinsicht getan haben sollte, ist unsere Gesellschaft von echter Barrierefreiheit weit entfernt. Menschen mit Behinderungen und ihre Lebenswelt werden zumeist nicht mitgedacht. Wenn Accessibility (Zugänglichkeit) überhaupt eine Rolle spielt, wird sie zumeist erst im Nachhinein in ein bestehendes System integriert. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass oft genug nötige Veränderungen nicht mehr oder nur mit sehr großem finanziellem Aufwand möglich sind. Leider trifft das auch auf staatliche Stellen zu. Diese Mehrfachbelastung führt nicht selten dazu, dass behinderte Menschen zusätzlich unter Depression leiden.
[…], denn der Staat hat mir endgültig klar gemacht, dass er mich nicht will. Dass er mich nicht nur nicht gebrauchen kann, sondern es ihm auch egal ist, ob ich menschenwürdig lebe oder nicht.
Die Gründe dafür sind leider vielfältig und schwer zu betiteln. Britta Redweik schreibt selbst, dass jede behinderte Person eine andere Art von Unterstützung braucht und das Richtige für die eine Person sogar das völlig Falsche für eine andere Person sein kann. Eindeutig ist aber, dass Entscheidungsträger:innen zumeist über die Köpfe der Betroffenen hinweg entscheiden, ohne tatsächlichen Einblick in deren Bedürfnisse zu haben. Allzuoft ohne die Betroffenen auch zur zu FRAGEN:
NIEMAND, der nicht mindestens einmal die Woche miterlebt, wie schwer das Leben mit Behinderung ist, sollte sich anmaßen dürfen, für uns zu entscheiden.
In diesem Sinne möchte ich wirklich jeder Person die Lektüre dieses Buchs ans Herz legen. Selbst wenn ihr mit einer anderen Behinderung lebt, kann euch dieses Buch konkrete Einblicke geben, die euch bisher vielleicht verborgen geblieben sind. Wenn ihr selbst keine Behinderung habt, dann natürlich erst recht. Schaut über euren Tellerrand und versucht, in eurem Arbeits- und Freizeitalltag darauf zu achten, wo Barrieren für behinderte Menschen vorhanden sind und wie ihr diese vielleicht abbauen könnt. Die Autorin gibt euch dafür noch einen ganz persönlichen Grund mit: Die meisten behinderten Menschen sind höheren Alters. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass ihr später in eurem Leben selbst zu diesen behinderten Menschen gehören werdet.