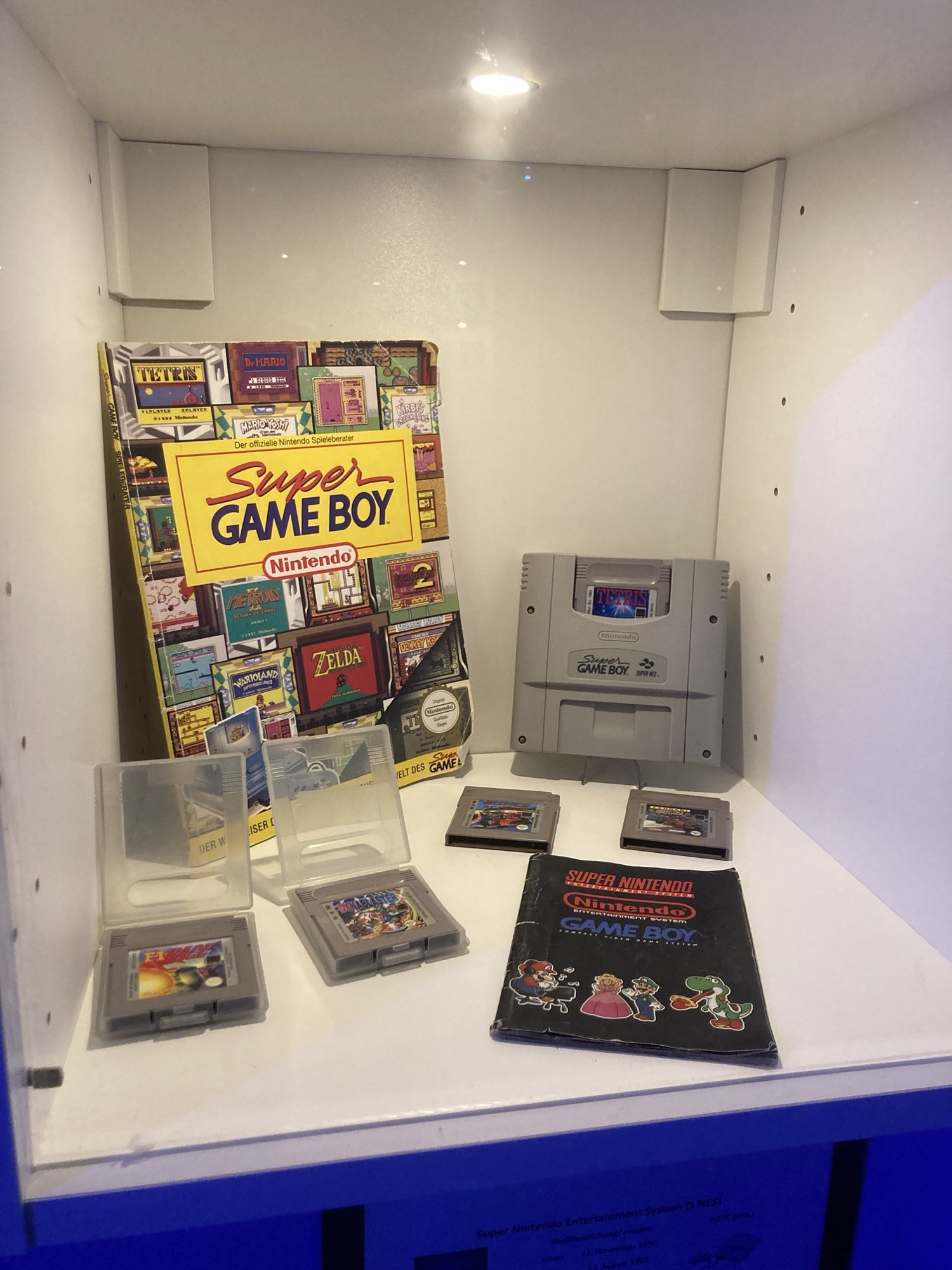Kürzlich Vor viel zu langer Zeit habe ich auf meinem Mastodon-Account nach Leseempfehlungen gefragt:
Ich würde gern mehr lesen:
* von Selfpublishing-Autor:innen
* über nicht-traditionelle Lebensformate/Lebensumstände (Polyamorie, queer, trans, adhd/autism, disabled)
* Memoir, real-life-stories, persönliche Erfahrungen
Die gesammelten Empfehlungen findet ihr weiter unten nach der heutigen Buchrezension.
CN: Fehlgeburt, Tod von nahestehenden Personen, Trauer
[…] love is a lifelong project, a story that we can’t skip to the end of. How lucky are we, to know we will never finish it? Because there is never a final page, only a series of beginnings.
Die Autorin unternimmt eine Reise durch die verschiedenen Formen der Liebe, die uns im Verlauf unseres Lebens begegnen (können). Sie führt Interviews mit Menschen über unterschiedliche Beziehungsformen (nicht im Polyamory oder No-Mono-Sinn, sondern einfach die unterschiedlichen Formen der Beziehungen, die wir mit anderen Menschen haben können, wie mit Eltern, Geschwistern, Partner:innen, Freund:innen, …) und untersucht dabei implizit auch die verschiedenen Rollen, die wir in diesen Beziehungen annehmen können.
We have this romantic ideal that we will find ‘The One’, a soulmate, a one and only. And in this romantic union, we believe that we are also ‘The One’ for our partner. We believe we are unique, irreplacable and indispensible.
Im Rückblick auf ihre früheren Versuche, romantische Liebe zu finden, geht die Autorin auch kritisch mit ihrem jüngeren Selbst ins Gericht. Sie hinterfragt, warum wir romantischen Beziehungen so viel mehr Wert geben als Freundschaften? In Polyamorie-Thematik kommt diese Frage üblicherweise in der Form: Warum soll ich mehrere Freundschaften haben können, aber nicht mehrere romantische Partnerschaften? Beides geht jedoch in eine ähnliche Richtung: Warum bewerten wir Freundschaften anders als romantische Partnerschaften?
Sie kommt zu dem Schluss, dass es eine Falle sein kann, romantische Liebe als die Lösung unserer Probleme zu sehen. Zu oft klammern wir uns an Illusionen, wir verlieben uns nicht in die Person, die vor uns steht, sondern in unsere Vorstellung von dieser Person. Ein anderes wiederkehrendes Thema ist der kapitalistische Druck, unter dem wir in der westlichen Welt heute täglich stehen: Die Werbung suggeriert uns, dass wir immer noch mehr, immer noch etwas Besseres haben könnten. Das kann unbewusst dazu führen, dass wir nie zufrieden sind mit dem Leben, mit der Partnerschaft, die wir jetzt gerade haben.
Im Zusammenhang mit ihrem Wunsch nach Elternschaft, der zuerst zu einer Fehlgeburt führt, gehen die späteren Kapitel des Buchs sehr in Richtung Trauer und was der Verlust von geliebten Menschen bedeuten kann. Mehrere Dinge passieren gleichzeitig oder ineinander verwoben:
- Die Liebe für die verstorbene Person geht nicht weg.
- Die Trauer um den Verlust der Person begleitet uns unser weiteres Leben lang.
- Oft ist es nicht nur die Trauer um diese Person, sondern um ein Stück unserer eigenen Identität, das wir mit dieser Person verloren haben.
How do you mourn the loss of a future you never really had?
Die traurige Realität ist, dass wir niemals völlig über Trauer hinweg kommen. Wir lernen nur, damit zu leben.
Ich habe unzählige Zitate mehr aus diesem Buch heraus geschrieben. Aber ich glaube, jede:r sollte es selbst lesen, um sich das herauszuholen, was zu seinem eigenen aktuellen Leben, zur aktuellen Liebes- und Beziehungssituation passt. Wenn ihr gerade selbst mit dem (unerfüllten) Wunsch nach Elternschaft ringt, ist das vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, dann könnte euch das Buch zu nahe gehen.
Abschließend möchte ich noch einige der interviewten Personen aufzählen, viele von ihnen haben selbst Bücher veröffentlicht, die ich auch schon gelesen und beschrieben habe, alle sehr empfehlenswert:
- Alain de Botton: Essays in Love, The Art of Travel
- Heather Havrilesky: What If This Were Enough?
- Esther Perel: Mating in Captivity (gelesen, aber nicht darüber geschrieben, das passiert selten, aber doch)
- Ariel Levy: The Rules Do Not Apply
- Lisa Taddeo: Three Women
- Paul Kalanithi: When Breath Becomes Air (das Interview hier ist mit seiner Witwe Lucy Kalanithi, die auch das Buch nach seinem Tod fertig gestellt hat)
Kürzlich Vor viel zu langer Zeit habe ich auf meinem Mastodon-Account nach Leseempfehlungen gefragt:
Ich würde gern mehr lesen:
* von Selfpublishing-Autor:innen
* über nicht-traditionelle Lebensformate/Lebensumstände (Polyamorie, queer, trans, adhd/autism, disabled)
* Memoir, real-life-stories, persönliche Erfahrungen
Und ich habe eine Flut an Empfehlungen bekommen! Ursprünglich habe ich versucht, mir jede Empfehlung zumindest oberflächlich anzusehen, um sie einordnen zu können. Da ich das aber 6 Monate danach noch immer nicht geschafft habe, veröffentliche ich hier eine vollständige Liste aller Empfehlungen, teils mit mehr oder weniger Background, je nachdem, wie es mir möglich war.
Die Genre-Zuordnungen sind von mir und beruhen nicht auf den Texten bzw. Meinungen der empfehlenden Personen (außer wenn konkret als „Zitat“ ausgewiesen). Ich hätte das gerne alles genauer gemacht, aber dann wäre dieser Post wohl nie fertig geworden … daher sind hier teilweise mehr oder weniger Infos verfügbar, gegebenenfalls werde ich später noch welche ergänzen, wenn ich mich mit den Empfehlungen näher befasst habe.
Sachbücher
Emilia Roig – Das Ende der Ehe: Über dieses Buch habe ich bereits im Lila Podcast gehört (Empfehlung, ich fand die Episode interessant). Es ist ein Sachbuch und hinterfragt, wie die Institution der Ehe gesellschaftliche Strukturen tradiert und Geschlechterrollen normiert.
Leena Simon – Digitale Mündigkeit: Dieses Buch habe ich tatsächlich schon im Regal der ungelesenen Bücher stehen, weil ich letztes Jahr dachte, ich würde es für eine Hausarbeit benötigen, die ich dann aber aus Gründen nicht geschrieben habe. Das Sachbuch hinterfragt Chancen und Risiken der Digitalisierung, erklärt den bildungswissenschaftlichen Begriff der Mündigkeit und seine Bedeutung für Freiheit und Demokratie in unserem digitalisierten Zeitalter.
Tanja Kollodzieyski beschäftigt sich mit Ableismus
Durchgeschüttelt und auf den Kopf gestellt von Petra Lachinger
Romane (verschiedener Genres)
Self-Publishing-Autorin Anni Bürkl schreibt Krimireihen mit Schauplätzen im Ausseer Land sowie in Wien, unterhaltsame Literatur, aber auch Zeitgeschichte. Wir sind auf Mastodon miteinander bekannt, ich habe kürzlich zwei ihrer Bücher „testgelesen“. Ihre Reihe „Haus der Freundinnen“ bestehend aus drei Büchern habe ich mir auf die Leseliste gesetzt.
Self-Publishing-Autorin Nike Leonhard schreibt Fantastik: „rachsüchtige Geister, zweifelhafte Heilige, betrügerische Vampire, verärgerte Dryaden und ähnliches. Liebe und Romantik kommen vor, sind aber nur ein Aspekt von vielen“.
Maike Claußnitzer (@ardeija@literatur.social) ist als Übersetzerin tätig und schreibt selbst historische Fantasy in Form von Romanen und Geschichten. In ihrem Roman Tricontium (Leseprobe, PDF) versuchen eine Richterin, ein Hauptmann und ein Dieb die Hintergründe eines Spukgeschehens aufzuklären. Dieses Buch habe ich auf meine Wunschliste gesetzt und bin gespannt darauf.
Amalia Zeichnerin (@amalia12@mastodon.social) schreibt viktorianische Krimis, Phantastik und Romance und zeichnet Fantasylandkarten und Charakterportraits. Ihre Landkarten sind wunderschön, ihr könnt Beispiele unter diesem Link sehen. Speziell ihre Reihe „Hexen in Hamburg“ („eine Mischung aus Urban Fantasy, Cosy Mystery und magischem Realismus“) wurde mehrfach empfohlen und ich werde auf jeden Fall mal reinlesen.
Sanguen Demonis von @anna_zabini (diesen Account scheint Anna aufgegeben zu haben) klingt für mich auch sehr spannend, spielt in Wien und wird vom Verlag als Dark/Urban Fantasy LGBTQIA+ Roman beschrieben. Eine Leseprobe gibt es auf der Webseite des Verlags.
Derselben Person gefiel auch „Knochenblumen welken nicht“ von Eleanor Bardilac (das Buch ist bei den großen Onlinehändler:innen zu finden). Aus dem Verlagstext:
Das erfrischend andersartige Fantasy-Debüt von SERAPH-Gewinnerin Eleanor Bardilac begeistert mit vielschichtigen Charakteren, einer packenden Story und einer detailreichen Götterwelt.
Die Fortsetzung „Knochenasche rottet nicht“ ist im Ohne Ohren Verlag erschienen.
Mehrmals empfohlen wurde Judith Vogt (@Atalante), speziell ihre Werke Anarchie Déco und Schildmaid. Schildmaid wird als eine „moderne Interpretation nordischer Sagen“ beschrieben und spielt in einem Wikinger-Milieu. Über Schildmaid schrieb eine andere Person:
Das hat die schönste trans Repräsentation, die ich bisher in einem Fantasytitel gelesen habe.
Anarchie Déco spielt im Berlin der 1920er-Jahre, jedoch inklusive magischer Elemente, die diese Epoche in ein anderes Licht rücken. Beides klingt für mich sehr spannend, ich verfolge auch die Serie von Volker Kutscher, die im Berlin dieser Zeit spielt, mit großem Interesse. Auf ihrer Webseite finden sich neben Romanen und Hörspielen auch Rollenspiele.
So ziemlich alle meine Kriterien dürfte Romy Wächter erfüllen, sie wurde mehrmals empfohlen, in ihrem Mastodon-Profil schreibt sie:
Meine #queer.en Werke behandeln u. a. die Themen #Autismus #BDSM #Liebe #Asexualität #Polyamorie #Partnerschaftsgewalt #Depression #Psychologie #MentalHealth #Suizidalität #Feminismus
Die Trilogie klingt für mich so spannend, dass ich eigentlich sofort loslesen möchte (aber dann würde dieser Post niemals fertig … ihr wisst schon …):
Vor dem Hintergrund eines Kriminalfalls entspinnt sich mit Paranuit ein queerer Entwicklungsroman von hoher erzählerischer Dichte, in dem sich erotische, spannende und psychologische Elemente ineinanderfügen. Minutiös und dialogverliebt wird die Entstehung zwischenmenschlicher Beziehungsgeflechte abgebildet.
Lana Harper – ‘Payback’s a Witch’ und die anderen Romane der Reihe
Gennadi Ratson – Dunkel am Ende des Lichts
Ifleria-Reihe von Effie Calvin („Prinzessinnen, die Prinzessinen heiraten, Drachen und viel Fantasy-Content“)
die Bücher von Vicorva
Die Haptik der Wände von @skalabyrinth (muss ich mir unbedingt anschauen, ich war begeistert von Wenn es nicht passiert)
Maschinenmacht von E. V. Ring
Akwaeke Emezi: „Pet mit gebärdendem trans Teen als Hauptperson, The Death of Vivek Oji, Freshwater und You made a Fool of Death with your Beauty“
Verschiedenes
Queer*Welten: Mastodon, Website, Verlag
Queer*Welten ist ein alle sechs Monate erscheinendes queerfeministisches Science-Fiction- und Fantasy-Zine, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kurzgeschichten, Gedichte, Illustrationen und Essaybeiträge zu veröffentlichen, die marginalisierte Erfahrungen und die Geschichten Marginalisierter in einem phantastischen Rahmen sichtbar zu machen.
Poetry von Justin Chin, z.B. “Gutted” (Englisch)
Eva Maria Wohlfahrter hat auf ihrem Bl0g Gespräche mit schwer traumatisierten Menschen veröffentlicht.
Kurzgeschichte „LichtTraum“ von I. L. Villiam: „Lunarpunk, möglicherweise Slice of Life“
Quellen / Listen
Libreture ist eine Sammlung von Webseiten, wo es DRM-freie Bücher, Comics oder Magazine zum Download gibt. Zuerst hat mich die Aufmachung etwas überfordert. Am ehesten hilft aber die Suche nach einem Genre weiter, wie auch ganz oben auf der Seite empfohlen wird. Mit Suchbegriffen wie „sci-fi“, „speculative fiction“ oder „cozy crime“ findet ihr hier am ehesten, was euch interessieren könnte. Ich habe mir ein paar der verlinkten Webseiten angesehen, darunter waren:
- Silver Sprocket: „independent publisher championing socially conscious and independently produced comic books, graphic novels, and related arts.“ Im Online-Store findet ihr Comics + Zines, T-Shirts, Patches, Sticker, Music und Pins.
- Qindrie Press: an independent comics publisher based in Edinburgh, Scotland, founded by comic creator Eve Greenwood in 2020. Die Werke gibt es jeweils als Buch oder als PDF-Download zu erwerben, wobei die PDF-Downloads sehr günstig sind. Ins Auge gestochen ist mir When I Was Me: Moments of Gender Euphoria (PDF-Download: 4 GBP).
- Morgana Best: „writes cozy mysteries packed to the brim with compelling plots, quirky characters, and a furry friend or two“. Sie schreibt Serien, also für alle, die gerne binge-lesen, es gibt genug Material. Außerdem enthält ihre Webseite süße Tierfotos ;-)
Weiters wurde empfohlen die Buchliste: „Phantastik mit Diversität“ gepflegt von Amalia Zeichnerin von 2019–2022. Es handelt sich um ein Google Doc, in dem mittels Suchfunktion bequem nach verschiedenen Queer-Themen gesucht werden kann.
Literaturliste zu Progressiver Phantastik fürs Brecht-Haus von Judith Vogt
Und hier noch eine Quelle, die ich mir selbst vor Kurzem in die Bookmarks gespeichert habe: Möchtegern hat in ihrem Autorinnenblog über queere Buchbegegnungen beschrieben.