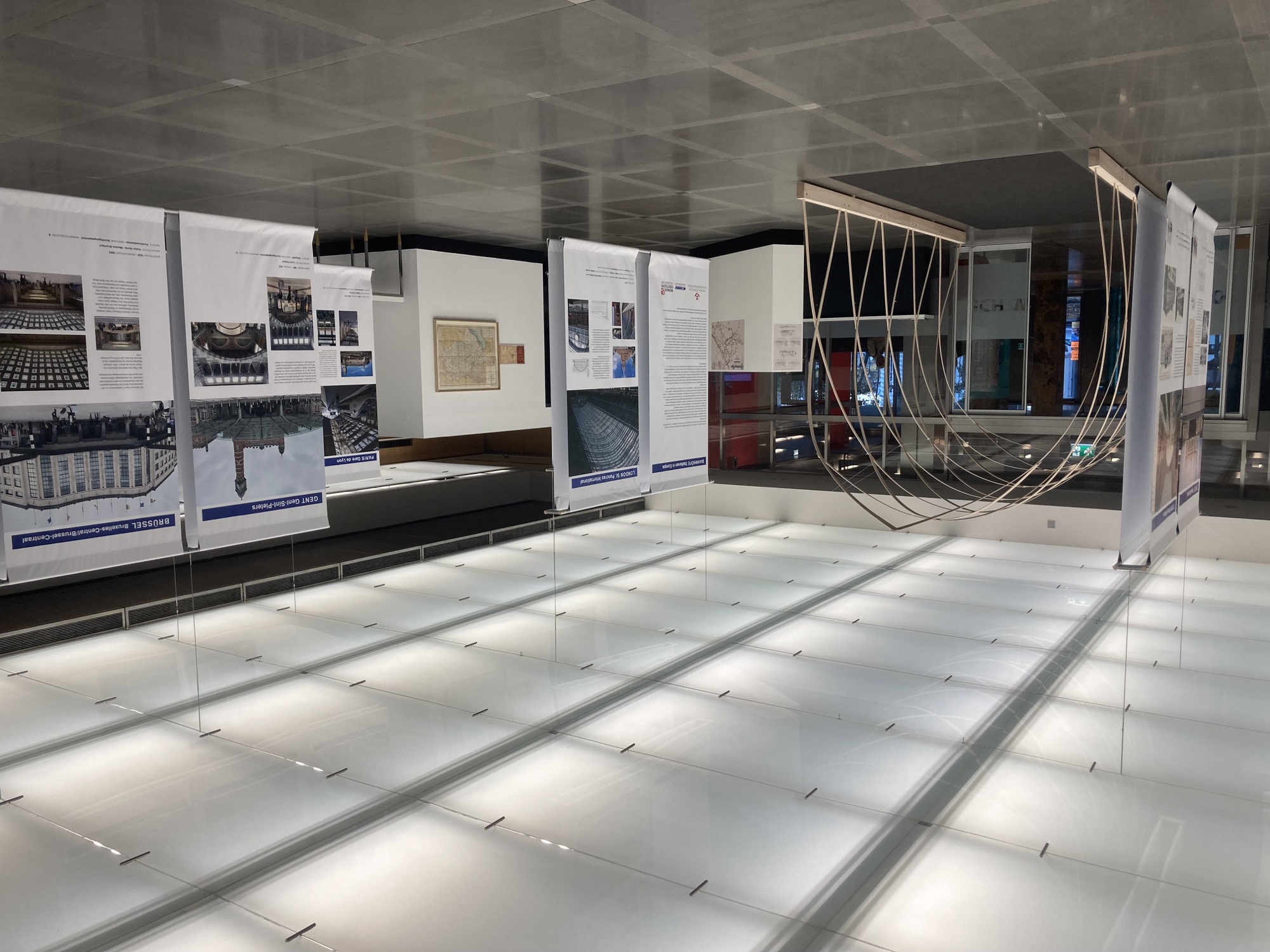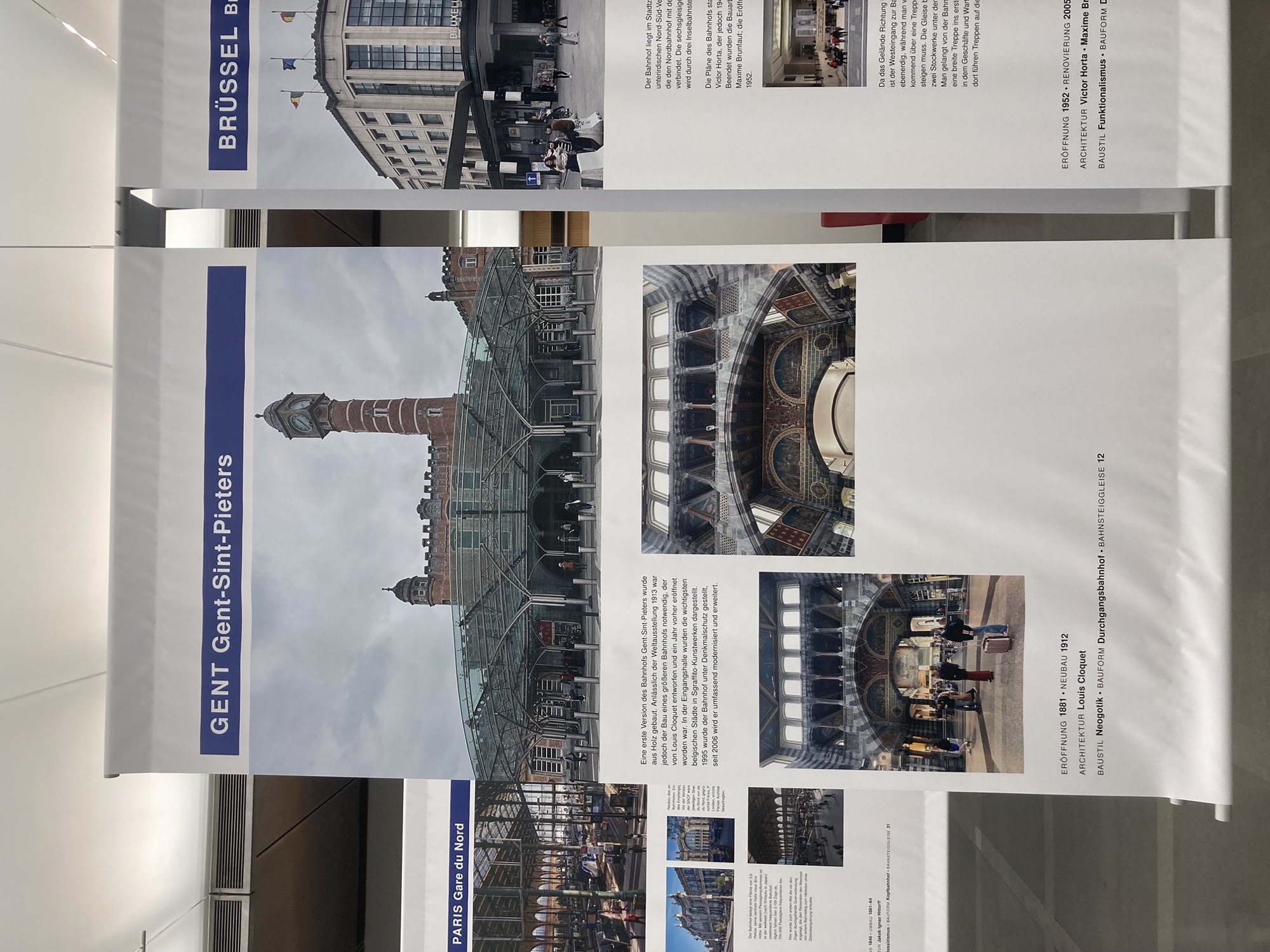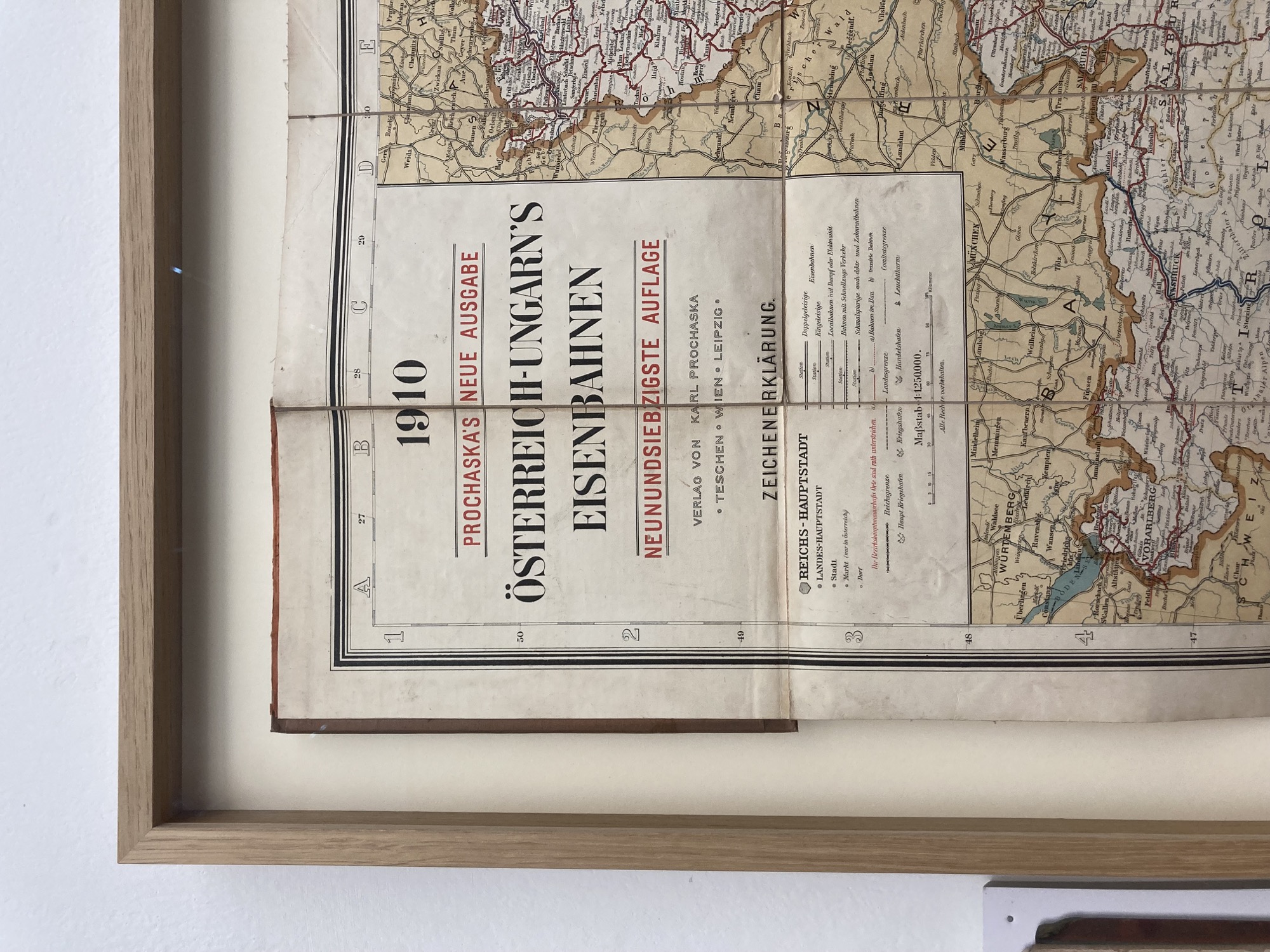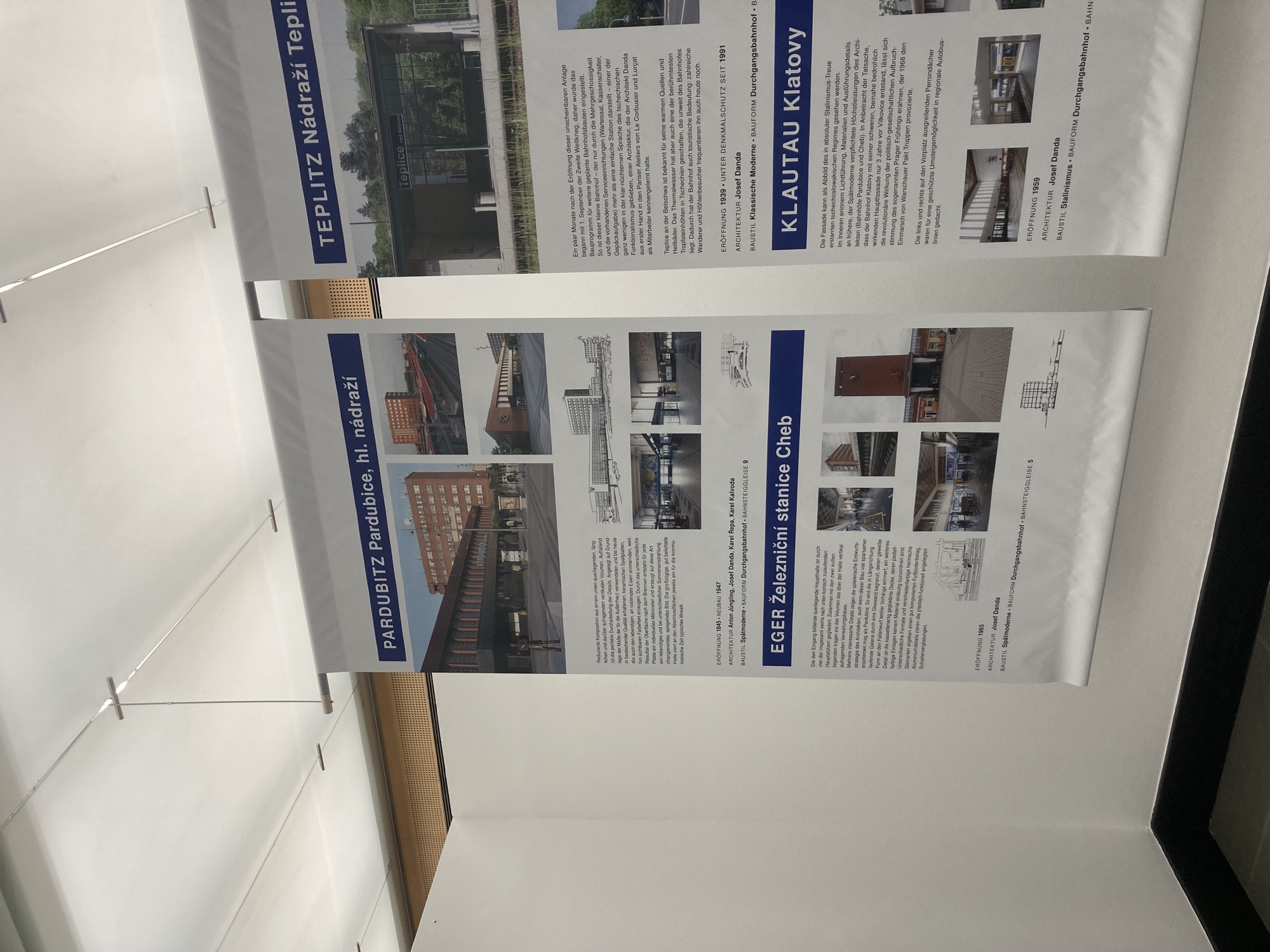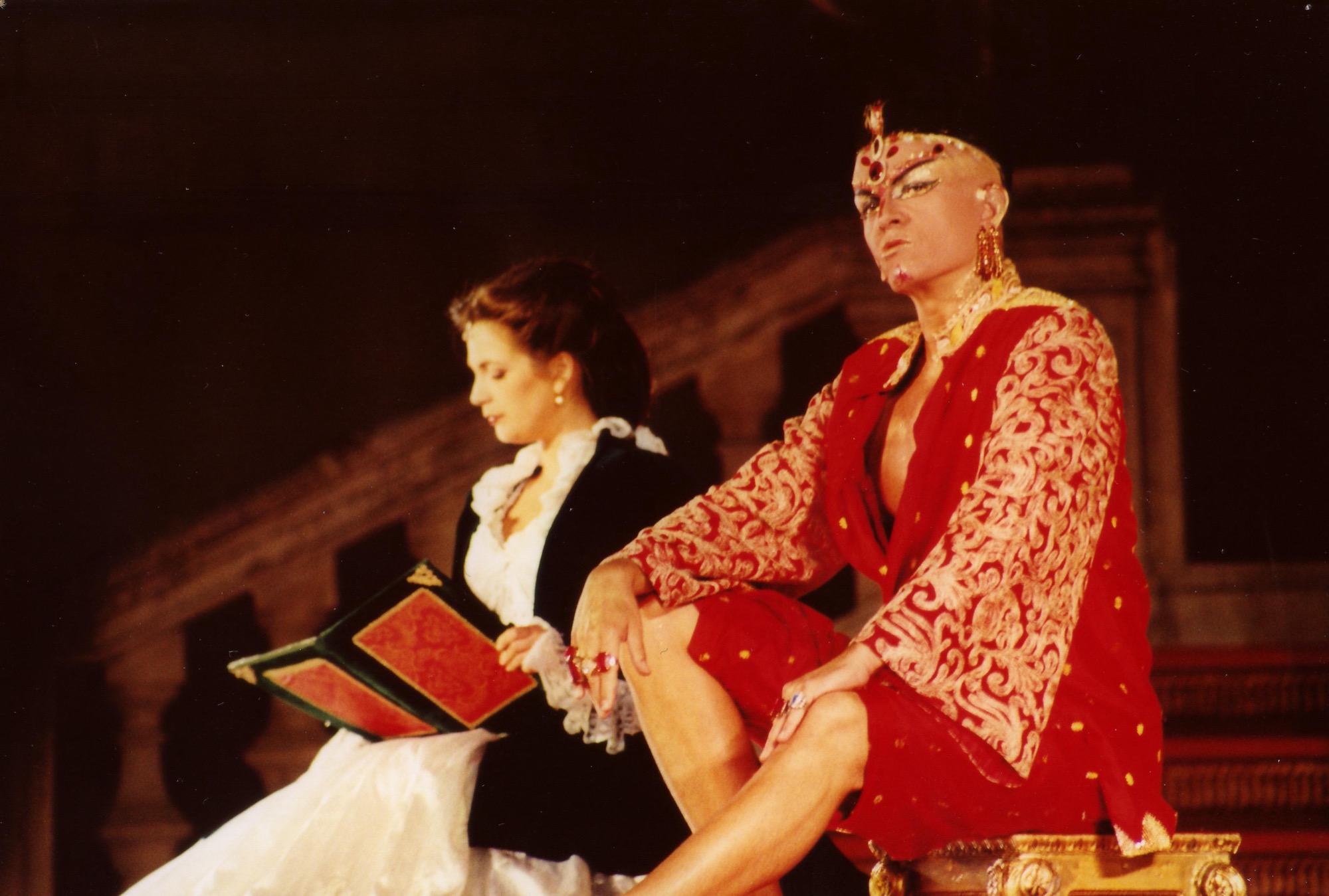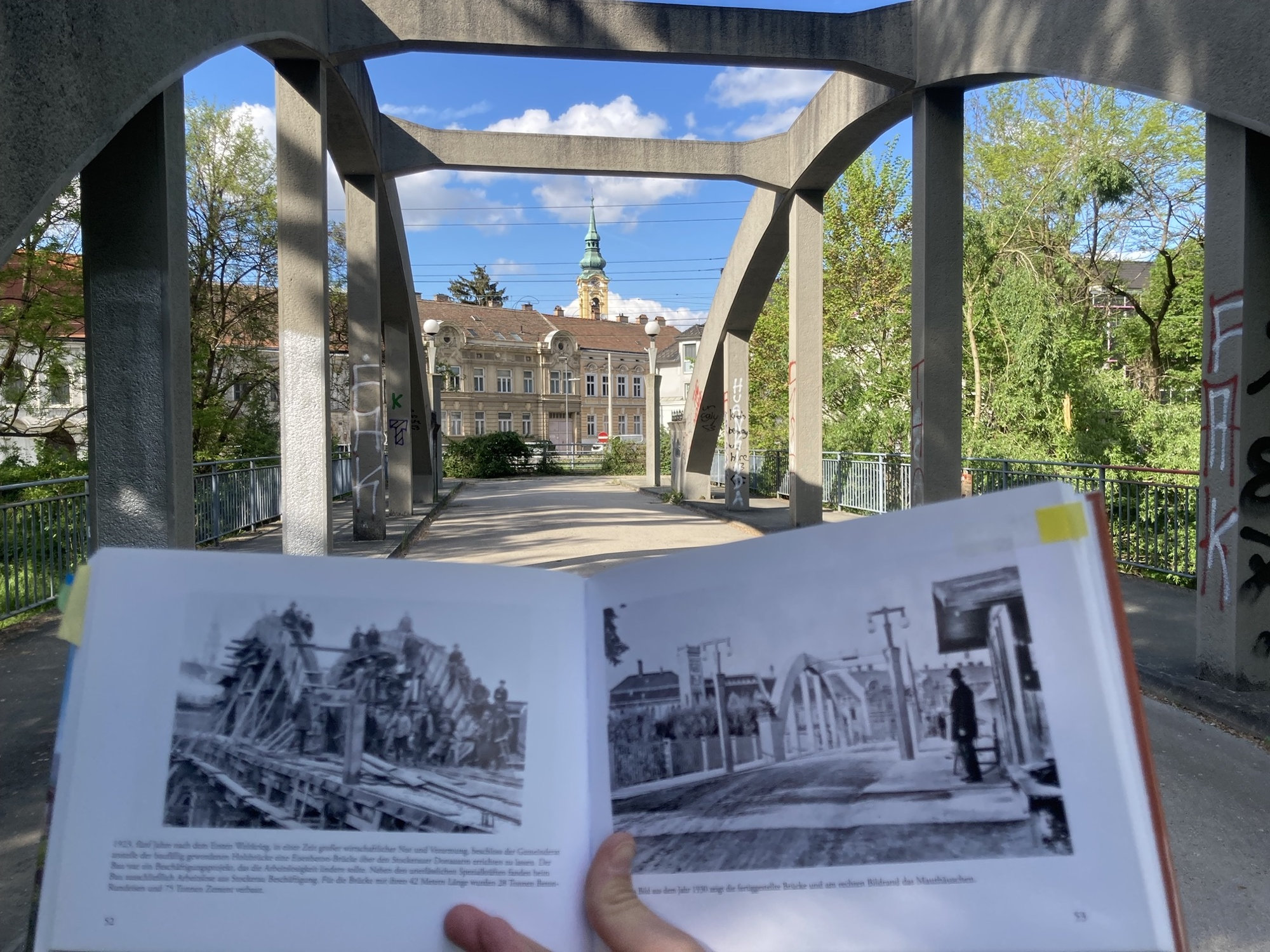CN: Erwähnung von (digitaler) Gewalt, Krieg, sexuellem Missbrauch (nur im Buch und auch dort keine grafischen Beschreibungen)
Dieses Buch habe ich mir direkt zur Erscheinung 2023 bei digitalcourage vorbestellt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, dass ich es für eine Hausarbeit im Rahmen meines Bildungswissenschaftsstudiums benutzen würde. Die Kombination aus Digitalisierung, Medienkompetenz und Mündigkeit war (und ist) für mich ein extrem spannendes Thema. Ich frage mich immer wieder, warum Menschen sich nicht mehr Mühe geben, ihr digitales Umfeld besser zu verstehen (und ich kenne viele Antworten auf diese Frage). Das Studium habe ich schweren Herzens aufgegeben und daher stand das Buch seit 2023 im Regal der ungelesenen Bücher.
Der Begriff Mündigkeit allein ist ja schon in höchstem Maße erklärungsbedürftig. Während der Lektüre bin ich selbst grandios gescheitert bei dem Versuch, den Begriff einer Person zu erklären, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Das von Immanuel Kant im Rahmen der Aufklärung geprägte Konzept ist weit verbreitet (und tief in der deutschen Sprache verwurzelt) und wurde von Theodor W. Adorno im 20. Jahrhundert erneut aufgegriffen. Die Definitionen dieser Denker könnt ihr auf Wikipedia (oder in Originalquellen) nachlesen, hier lest ihr meine eigene Interpretation.
Für mich ist Mündigkeit in höchstem Maße mit Verantwortung verknüpft. Als mündige Menschen übernehmen wir Verantwortung für unser Handeln. Wir treffen Entscheidungen und übernehmen dafür die Verantwortung. Um diese Entscheidungen verantwortungsvoll treffen zu können, benötigen wir Informationen. Diese Informationen müssen wir uns selbst beschaffen, sie werden uns nicht auf dem Silbertablett serviert. Wichtig ist jedoch auch die Bewertung dieser Informationen anhand eines moralischen Systems.
Es gibt nicht die eine Art, mündig zu sein. Mündigkeit ist eine Haltungsfrage. […] Es geht darum, die eigenen Handlungen zu hinterfragen, unbequeme Fragen zu stellen und unbequeme Erkenntnisse auszuhalten. Es geht darum, sich mit den Konsequenzen des eigenen Handelns im digitalen Raum zu konfrontieren und für sie Verantwortung zu tragen.
Am Beispiel einer paternalistischen Ampel erklärt die Autorin, warum es von zentraler Bedeutung ist, dass Menschen stets die Macht über die Technik behalten, die sie umgibt. Eine reguläre Fußgänger:innenampel, wie wir sie heute kennen, lässt sich von einem einzelnen Menschen immer trotz Rotlicht überschreiten. Eine paternalistische Ampel würde das irreguläre Überschreiten der Ampel durch eine Mauer verhindern. Kommt es nun zu einer ungeplanten Situation (ein:e Radfahrer:in stürzt auf der Straße und braucht Hilfe), kann ein Mensch die Entscheidung der Ampel nicht überstimmen, wenn er durch eine Mauer am Betreten der Straße gehindert wird. Der menschliche Verstand würde uns selbstverständlich gebieten, bei freier Straße alles zu tun, um dem gestürzten Menschen zu helfen. Wenn uns jedoch die Technik daran hindert, die uns eigentlich schützen soll, hindert sie uns daran, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und diese verantwortungsvoll umzusetzen.
Auch wenn solche Situationen nur in Ausnahmefällen vorkommen, verdeutlichen sie, warum es immer eine Möglichkeit zur Überbrückung der Technik geben muss. Es ist nicht möglich, alle Situationen vorherzusagen. Technik muss darauf eingestellt sein, dass es Ausnahmefälle gibt, in denen es notwendig ist, ihre Entscheidungen zu revidieren.
Um mündige Entscheidungen zu treffen und diese auch umzusetzen, braucht es also die Freiheit, das auch zu tun. Diese Freiheit wird in unserer heutigen Zeit zunehmend eingeschränkt. Paternalistische Technik nimmt uns etwa die Freiheit, mit welchem Programm wir unsere Daten bearbeiten wollen. Eine Datei, die in einem proprietären Format erstellt wurde, kann (oft) nicht mit anderen Programmen geöffnet oder bearbeitet werden. Auf viele Daten, die der Staat oder kommerzielle Unternehmen über uns sammeln, haben wir selbst überhaupt keinen Zugriff.
Die paternalistische Ampel ist ein extremes und gleichzeitig sehr praktisches Beispiel. Führen wir diesen Gedanken weiter, stoßen wir schnell auf die Frage, ob wir überhaupt noch versuchen würden, eigene Entscheidungen zu treffen, wenn uns die paternalistische Ampel und ihre einschränkenden Geschwister ohnehin alle Entscheidungen abnehmen. Der Aufruf zur digitalen Mündigkeit ist deshalb so notwendig, weil viele Menschen in vielen Bereichen ihre Entscheidungsfreiheit bereits aufgegeben haben. Wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, sich falsch zu entscheiden, gibt es auch keine Motivation mehr, überhaupt eigene Entscheidungen zu treffen. Wie das eigene moralische oder ethische Gewissen kann auch die Mündigkeit verkümmern, wenn wir keine Möglichkeit mehr haben, unsere Entscheidungen auch umzusetzen.
Wenn es keine Möglichkeit gibt, falsch zu handeln, kann sich kein Bewusstsein über richtig und falsch entwickeln. Die bewusste Entscheidung gegen das Falsche setzt voraus, dass man überhaupt die Wahl hat, das Falsche zu tun.
Speziell bei staatlichen Freiheitseinschränkungen wird oft argumentiert, dass sie zu unserer eigenen Sicherheit geschehen. Dies können wir aktuell anhand der Diskussionen über eine europaweite Chatkontrolle verfolgen. Im Namen der Verbrechensbekämpfung (oder -verhinderung) sollen wir einen massiven Teil unserer Privatsphäre aufgeben. Warum die Aussage, ein gesetzestreuer Mensch hätte nichts zu verbergen, falsch ist, hat die Autorin bereits 2017 in einem Digitalcourage-Artikel, der im Buch ebenfalls in leicht abgeänderter Form vorkommt, dargelegt.
Unsere Entscheidungen und Handlungen haben Konsequenzen. Das gilt auch für das unmündige Handeln. Wenn wir immer mehr Handlungsfreiheit an staatliche oder kommerzielle Organisationen abtreten, indem wir uns durch technologischen Paternalismus einschränken lassen, geben wir Stück für Stück unsere Freiheit auf, selbst verantwortungsvoll Entscheidungen zu treffen.
Digitale Mündigkeit beginnt mit der Entscheidung, Verantwortung für das eigene Handeln in der Kommunikationsgemeinschaft zu tragen. Dafür müssen Sie sich die Gefahren Ihres Handelns bewusst machen und sich ihnen mit Zuversicht stellen. Alles andere kommt mit der Zeit.
Leena Simon behandelt in ihrem umfangreichen Buch noch viele weitere Gedankenexperimente, theoretische Exkurse und Digitalthemen und lädt dazu ein, selbst aktiv zu werden und sich mit dem mündigen Handeln in der digitalen Welt auseinanderzusetzen. Konkrete Anregungen, wie wir uns unsere Entscheidungsfreiheit in der digitalisierten Welt zurückerobern können, sind jedoch dünn gesäht. Dafür gibt es jedoch andere Quellen, eine davon ist zum Beispiel Dann haben die halt meine Daten. Na und‽ von Klaudia Zotzmann-Koch. Digitalcourage liefert mit ihrer Wissensreihe kurz&mündig Überblick und Anleitungen zu aktuell (November 2025) 32 Themen.
Eine der Antworten auf meine eingangs erwähnte Frage, warum Menschen sich nicht mehr Mühe geben, ihr digitales Umfeld besser zu verstehen, ist Zeit, eine andere Komplexität. Die meisten von uns sind täglich beruflich und/oder privat mit Entscheidungen konfrontiert, die unsere digitale Mündigkeit betreffen. Eine wichtige Botschaft von Leena Simons Buch ist, dass es sich lohnt, diesen Aufwand zu betreiben. Wenn wir uns nicht eines Tages in einer Dystopie wiederfinden wollen, in der uns alle Entscheidungen durch Technik abgenommen werden, ist es sinnvoll und notwendig, jetzt darüber zu reflektieren und mit der Entscheidung für mündiges Handeln den ersten Schritt zu tun. Mit meiner kurzen Zusammenfassung konnte ich euch hoffentlich Mut machen, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen.
Randnotiz: Als an Typographie und Layout interessierte Person ist mir an diesem Buch einiges aufgefallen, was ich in diesem Post nicht unerwähnt lassen will, aber nicht von den Inhalten ablenken soll. Äußerst positiv finde ich den Umgang mit Fußnoten, Endnoten und Quellen. Englische Zitate werden in Fußnoten übersetzt, ergänzende Informationen verlinkt. Quellen sind im Anhang umfangreich aufgelistet. Feststellen musste ich allerdings, dass die Verwendung einer serifenlosen Schrift im Fließtext das Lesen für mich manchmal erheblich erschwert hat. Witwen (alleinstehende Sätze am Anfang oder Ende einer Seite) stören mein persönliches Ästhetikempfinden. Möglicherweise wurde daran in überarbeiteten Ausgaben etwas verändert, ich habe wie oben erwähnt die Erstausgabe erworben. Den Inhalten tut dies natürlich keinen Abbruch, es war mir allerdings (für mein eigenes Archiv) wichtig, auch dazu ein paar Zeilen zu schreiben.
#12in2025: 9/12