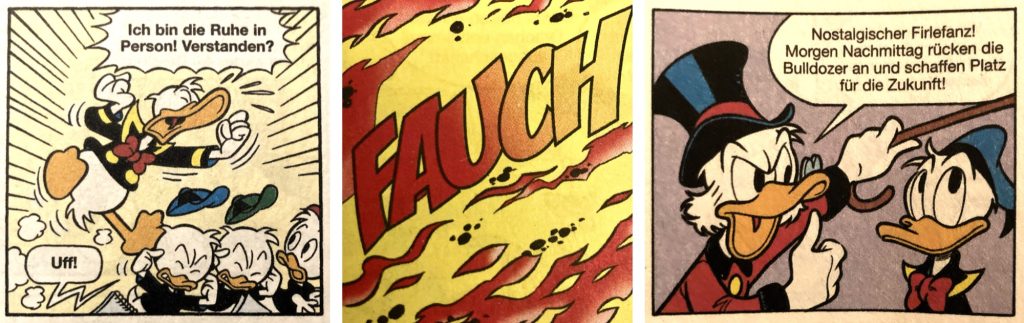CN: Dieses Buch kann als das verstanden werden, was heute oft als inspiration porn kritisiert wird, ist im Kontext seiner Zeit aber ein wichtiges historisches Dokument. Im Kontext der Zeit werden auch Themen wie Krieg, Holocaust und Rassismus thematisiert.
Helen Keller wurde 1880 in Alabama geboren. Im Alter von 19 Monaten erkrankte sie schwer und verlor im Zuge dieser Krankheit ihr Seh- und Hörvermögen, die Ursache ist bis heute nicht vollständig geklärt. Sie wurde also als Kleinkind, das gerade im Begriff ist, die Welt zu erkunden von zwei zentralen Sinneswahrnehmungen abgeschnitten, diese Erfahrung mag ich mir nicht mal vorstellen.
Ich wusste, dass meine Mutter und meine Freunde nicht, wie ich, Zeichen benutzten, wenn sie etwas mitteilen wollten, sondern mit ihren Mündern sprachen.
Bemerkenswert ist, dass sie sich von ihren Behinderungen nicht aufhalten lässt. Frustriert über ihr Unvermögen, sich verständlich zu machen, kämpfte sie immer wieder mit Zornesausbrüchen. Ihr Leben erfährt eine erneute Wendung, als ihre Eltern eine Privatlehrerin für sie finden, die ihr neue Kommunikationswege eröffnet und für ihr weiteres Leben prägend sein wird. Helen lernt das Alphabet, das ihre Lehrerin ihr in die Hand schreibt, erlernt in weiterer Folge das Braille-Alphabet und erlangt durch das Lesen vielfältige Kenntnisse über die Welt. Ich war immer wieder überrascht über ihren unstillbaren Wissensdurst, der sie schließlich alle möglichen Widerstände überwindend an die Universität führt.
Besonders poetisch sind ihre Beschreibungen, wie sie die Welt wahrnimmt, wie und was sie ohne Seh- und Hörvermögen spürt, wie hier in ihrer Beschreibung ihres ersten Besuchs am Strand:
Ich spürte das Rasseln der Kiesel, wenn die Wassermassen zurückrollten. Der ganze Strand war ihrem heftigen Ansturm ausgesetzt und die Luft pulsierte von ihrem Rhythmus. Die Wellen rollten zurück und formierten sich neu zu noch mächtigeren Brechern. Fasziniert und angespannt zugleich klammerte ich mich an den Felsen und spürte das gewaltige Krachen und Donnern der Brandung!
Es kann nicht unerwähnt bleiben, dass Helen in der privilegierten Situation aufwuchs, dass ihre Eltern nicht nur den Willen, sondern auch die finanziellen Mittel und Kontakte (unter anderem zu Alexander Graham Bell, der sich zeitlebens für die Ausbildung von gehörlosen Menschen einsetzte) hatten, um ihr die Ausbildung und ständige Begleitung durch eine Privatlehrerin zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz erscheint ihre Willenskraft und ihre unermüdliche Arbeit beinahe überirdisch, noch dazu in der damaligen Zeit.
Das vorliegende Buch beschreibt die ersten 20 Jahre ihres Lebens, ihre weitere Lebensgeschichte ist jedoch nicht weniger bemerkenswert (zum Beispiel hier auf Wikipedia nachzulesen). Ihre zunehmende Bekanntheit nutzte sie, um sich für die Ausbildung von behinderten Kindern und später für viele andere soziale Themen einzusetzen.
So viele Jahre später ist es leider immer noch (oder wieder) eine Tatsache, dass es behinderten Menschen außerordentlich erschwert wird, Bildung und Beschäftigung zu finden und an der Gesellschaft teilzuhaben. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, in dem wir uns über Protestformen austauschten, in dem sie meinte, die Gesellschaft würde sich eben langsam verändern und radikale Proteste würden diesen Prozess eher behindern, weil sie grob gesagt „unsympathisch“ auf die Mehrheitsgesellschaft wirkten (sehr verkürzt dargestellt, das ganze Gespräch würde den Rahmen sprengen). Helen Keller hat (aus meiner Sicht) auf Aufklärung und Verständnis gesetzt und trotzdem ist es nach so langer Zeit noch nicht selbstverständlich, dass behinderten und chronisch kranken Menschen die Unterstützung gegeben wird, die sie zur Teilhabe benötigen. Unsere Welt ist komplexer geworden und es mag im Alltag überfordernd sein, die vielen verschiedenen Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen und ihrer Lebensumstände zu verstehen und zu berücksichtigen. Was mir jedoch gerade das Herz bricht, ist, dass es so viele Menschen gibt, die das nicht mal versuchen wollen.
Mir selbst hat – wie auch Helen Keller – lange das Lesen andere Perspektiven auf die Welt ermöglicht. Heute kenne ich persönlich und über das Internet viele Menschen, die mit den unterschiedlichsten Herausforderungen in ihrem Alltag konfrontiert sind und dabei viel zu oft Abwertung und mangelnde Unterstützung erfahren. Uns, die versuchen wollen, eine Welt zu schaffen, in der allen Menschen gleich viel Wert beigemessen wird, in der allen Menschen die gleiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird, bleibt nur, die Hoffnung nicht zu verlieren, und weiter für Verständnis und Solidarität einzutreten. In jedweder Form, die wir für richtig halten.